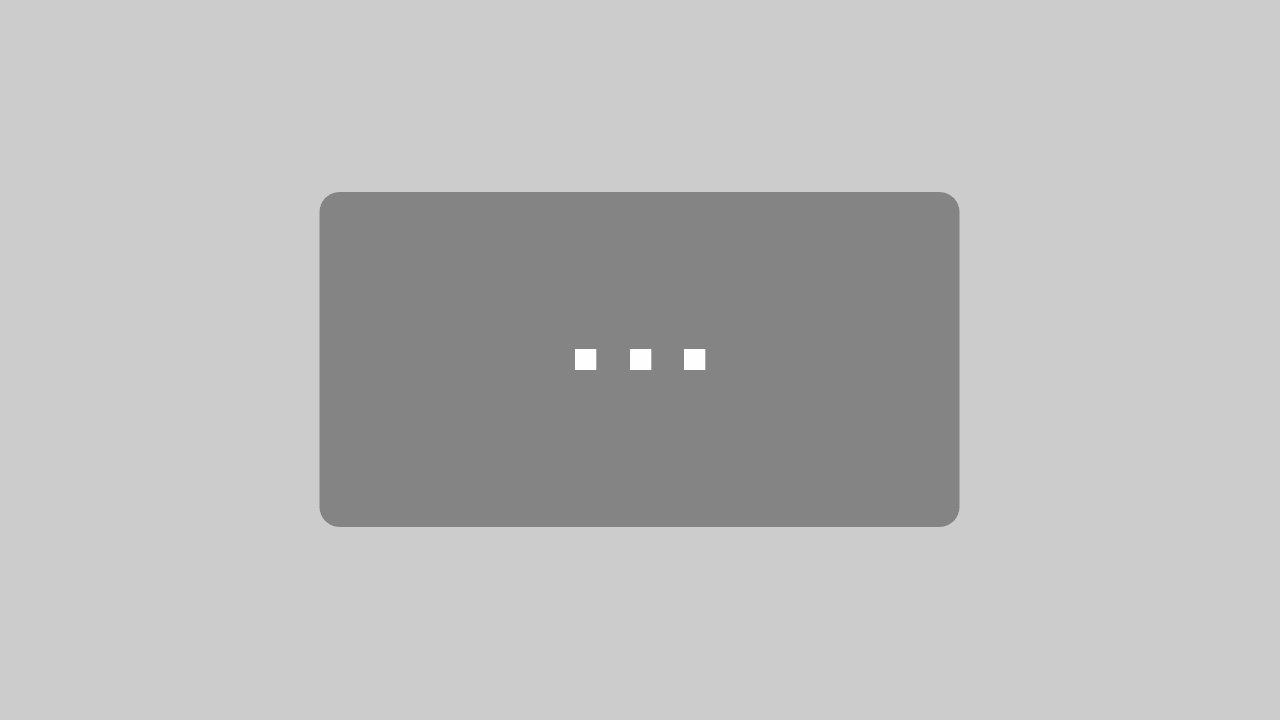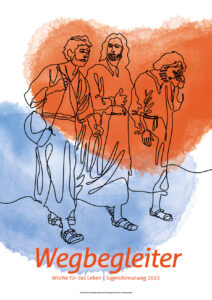Datenschutzerklärung
Deutsche Bischofskonferenz / Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) und Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Die Deutsche Bischofskonferenz und ihr Rechtsträger, der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), sowie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) freuen sich über Ihren Besuch auf der Webseite woche-fuer-das-leben.de. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch der Internetseite sicher fühlen.
Mit unseren Institutionen und Einrichtungen unterliegen wir den kirchlichen Regelungen zum Datenschutz, insbesondere der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) für die Dienststellen und Einrichtungen des VDD bzw. dem Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD). Es ist sichergestellt, dass die Vorschriften über den Datenschutz auch von beteiligten externen Dienstleistern beachtet werden.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe persönlicher Daten möglich.
Soweit auf dieser Seite die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse besteht (zum Beispiel im Rahmen einer persönlichen Registrierung, Bestellung, Anforderung oder Mitteilung), erfolgt die Angabe dieser Daten seitens des Besuchers stets auf freiwilliger Basis.
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge sowie für die technische Administration. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben. Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn die Kenntnis dieser Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Protokollierung
Zugriffe auf unsere Webseite und Abrufe einer auf der Webseite hinterlegten Datei werden protokolliert. Beim Zugriff auf die Seite woche-fuer-das-leben.de werden folgende technische Daten gespeichert:
- Adresse des Internet Service Providers (anonymisierte IP-Adresse),
- Verweis, von welcher Seite aus die Webseite aufgerufen wurde,
- Name der abgerufenen Seite bzw. Datei, die besucht wird,
- Datum und Uhrzeit des Abrufes bzw. der Anforderung,
- Dauer des Besuchs,
- aufgerufene Links,
- vom Nutzer verwendeter Browser einschließlich der Browserversion,
- vom Nutzer verwendetes Betriebssystem.
Die Speicherung dient ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Die Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Sie werden anonym und ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, um das Internetangebot attraktiver gestalten zu können.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung zu erhalten. Anträge auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Sperrung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten werden auf der Grundlage der geltenden rechtlichen Bestimmungen bearbeitet.
Bitte wenden Sie sich an die verantwortliche Stelle:
Verband der Diözesen Deutschlands (KdöR)
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter
Kaiserstraße 161
53113 Bonn
Telefon: 0228 / 103–239
E-Mail: bdsb-vdd(at)dbk.de
oder
Evangelische Kirche in Deutschland
Örtlicher Beauftragter für den Datenschutz
Herrenhäuser Str. 12
30419 Hannover
Telefon: 0511 / 2796-0
E-Mail: datenschutz-kirchenamt(at)ekd.de
Bei Fragen zur kirchlichen Datenschutzaufsicht auf der Grundlage der für die Deutsche Bischofskonferenz / den VDD geltenden kirchlichen Datenschutzregelungen, insbesondere der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) für die Dienststellen und Einrichtungen des VDD, wenden Sie sich bitte an
Datenschutzbeauftragter des VDD
Katholisches Datenschutzzentrum (KDSZ)
Brackeler Hellweg 144
44291 Dortmund
Telefon: 0231/138985–0
E-Mail: info(at)kdsz.de
www.katholisches-datenschutzzentrum.de
Bei Fragen zur kirchlichen Datenschutzaufsicht auf der Grundlage der für die Evangelische Kirche in Deutschland geltenden kirchlichen Datenschutzregelungen, insbesondere des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD), wenden Sie sich bitte an
Der Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland
Böttcherstraße 7
30419 Hannover
Telefon: 0511 /768128-0
E-Mail: info(at)datenschutz.ekd.de
https://datenschutz.ekd.de
Cookies und Websiteanalyse
Zum Zwecke der Webanalyse verwenden wir sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Dateien, die auf Ihrem PC abgelegt werden. Diese Cookies verfallen nach 24 Monaten automatisch, wenn Sie unsere Internetseite in diesem Zeitraum nicht erneut besuchen.
Wir greifen auf das Analyse-Tool „Matomo“ (früher Piwik) zurück. Matomo ist eine freie Webanalyse-Software, die unter matomo.org verfügbar ist. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Nutzung der Webseite werden zu Analysezwecken gespeichert.
Folgende anonyme Daten werden zu statistischen Zwecken und zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet:
- anonymisierte IP-Adresse,
- Name der abgerufenen Seite bzw. Datei, die besucht wird,
- Datum und Uhrzeit des Abrufes bzw. der Anforderung,
- vom Nutzer verwendeter Browser einschließlich der Browserversion,
- vom Nutzer verwendetes Betriebssystem.
Die IP-Adresse des Besuchers wird in Matomo durch das Anonymize IP-Plugin anonymisiert gespeichert und ist somit nicht auf den einzelnen Benutzer zurückzuführen. Die Informationen können nicht mit Personen in Verbindung gebracht werden und werden keinesfalls an Dritte übermittelt.
Wenige Informationen, die einen störungsfreien Ablauf dieser Webseite bedingen, werden ausschließlich für die Dauer der Sitzung im flüchtigen Arbeitsspeicher des Webbrowsers als sogenannter Sitzungs-Cookie gespeichert. Dieser und alle in ihm gespeicherten Informationen werden automatisch gelöscht, sobald das Browserfenster geschlossen wird.
Sie können Cookies jederzeit über die Einstellungen in Ihrem Browser löschen bzw. deaktivieren.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
- Browsertyp/Browserversion,
- verwendetes Betriebssystem,
- Referrer URL,
- Hostname des zugreifenden Rechners,
- Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Haftung und Links
Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.